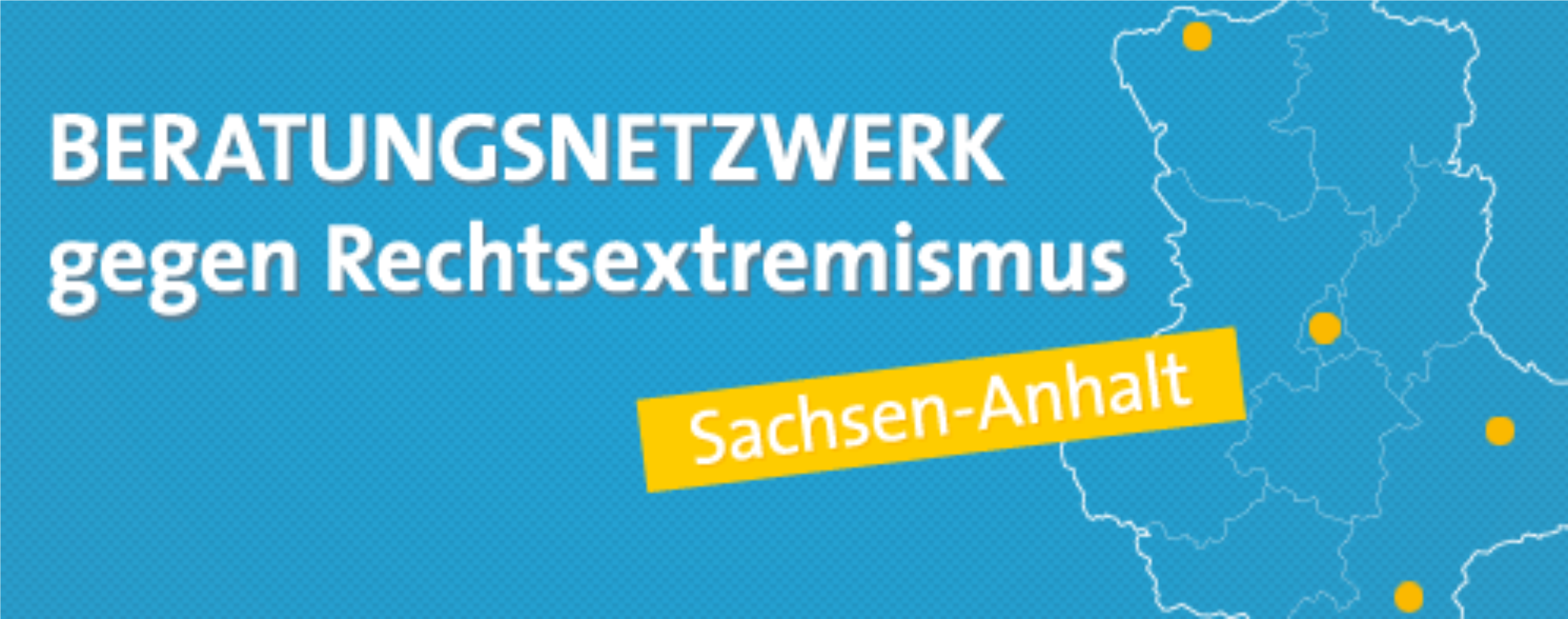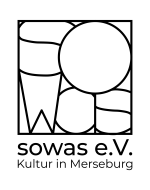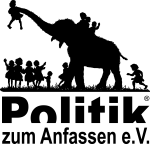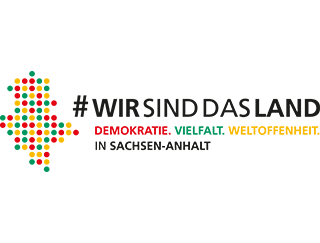Das Umgehen-müssen mit rassistischen und rechtsextremistischen Positionen gehört zum Alltag in der politischen Bildung. Nichtsdestotrotz kommt es dabei immer wieder zu offenen Fragen und Unsicherheiten, insbesondere wenn es um die rassistischen und rechtsextremistischen Positionen von politischen Parteien geht. Bei der Frage, ob und wie solche Positionen zu thematisieren sind, wird meistens auf das Neutralitätsgebot verwiesen.
Als Beitrag zu der Frage, wie Akteur*innen in der politischen Bildung rassistische und rechtsextreme Positionen von politischen Parteien thematisieren dürfen und eventuell sogar müssen, möchten wir euch folgende Analyse des Deutschen Instituts für Menschenrechte, der unabhängigen Nationalen Menschenrechtsinstitution Deutschlands, empfehlen:
Die Analyse „Das Neutralitätsgebot in der Bildung – Neutral gegenüber rassistischen und rechtsextremen Positionen von Parteien?“ widmet sich der rechtlichen Frage, „wie das parteipolitische Neutralitätsgebot, genauer das Recht der Parteien auf Chancengleichheit im politischen Wettbewerb (Artikel 21 Grundgesetz), im Bereich der schulischen und außerschulischen Bildung zu verstehen ist.“
Dabei argumentiert das Deutsche Institut für Menschenrechte, dass die Grund- und Menschenrechte auch für die politische Bildung die zentrale (rechtliche) Grundlage darstellen. Aus dem Neutralitätsgebot könne nicht abgeleitet werden, dass rassistische und rechtsextreme Positionen, die damit unverhandelbare Grundsätze des Grundgesetzes in Frage stellen, als gleichberechtigte legitime politische Positionen darzustellen sind. Deswegen seien Akteur*innen in der politischen Bildung sogar verpflichtet solche Positionen kritisch zu thematisieren.
Weitere Informationen finden Sie hier, die vollständige Analyse steht hier zum kostenlosen Download bereit.